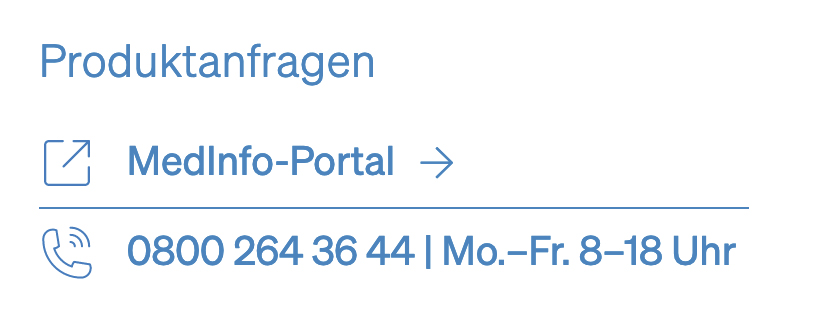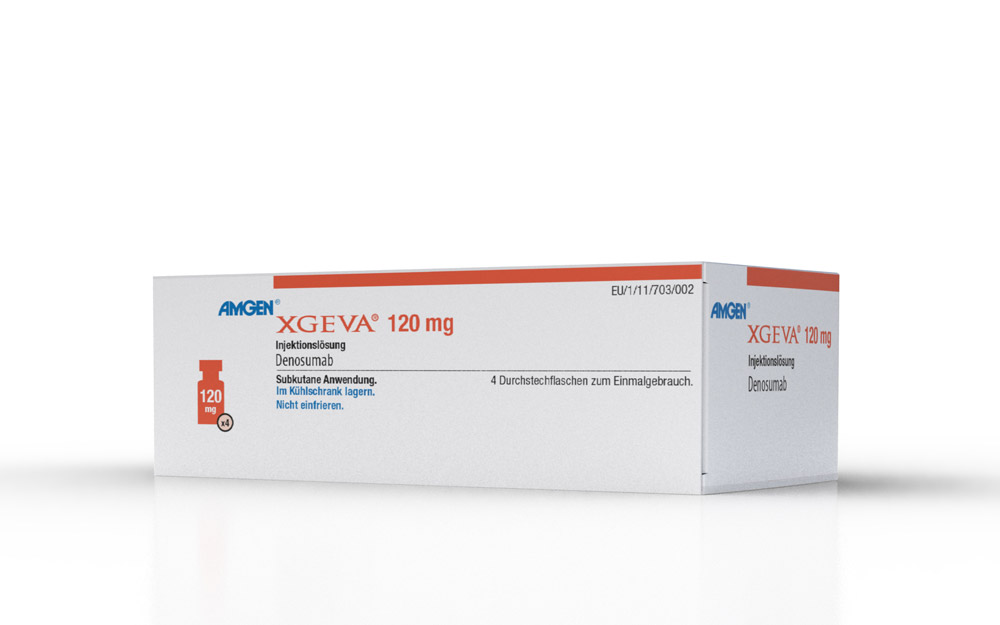Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Das Gesamtsicherheitsprofil stimmt in allen zugelassenen Anwendungsgebieten von XGEVA überein.
Über Hypokalzämie wurde sehr häufig nach XGEVA-Anwendung berichtet, meistens innerhalb der ersten beiden Wochen. Eine Hypokalzämie kann schwer und symptomatisch sein (siehe Abschnitt 4.8 – Beschreibung ausgewählter unerwünschter Wirkungen). Die Abnahmen des Serumcalciums konnten im Allgemeinen mit einer Calcium- und Vitamin D-Ergänzung angemessen behandelt werden. Die häufigsten unerwünschten Wirkungen von XGEVA sind muskuloskelettale Schmerzen. Fälle von Kieferosteonekrose (siehe Abschnitte 4.4 und 4.8 – Beschreibung ausgewählter unerwünschter Wirkungen) wurden häufig bei Patienten, die XGEVA anwenden, beobachtet.
Liste der unerwünschten Wirkungen in Tabellenform
Die folgende Konvention wurde, basierend auf den Inzidenzraten in vier klinischen Studien der Phase III, zwei der Phase II und der Erfahrung nach Markteinführung, für die Klassifikation der unerwünschten Wirkungen verwendet (siehe Tabelle 1): sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), gelegentlich (≥ 1/1 000, < 1/100), selten (≥ 1/10 000, < 1/1 000), sehr selten (< 1/10 000) und nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe und Systemorganklasse werden die unerwünschten Wirkungen nach abnehmendem Schweregrad aufgeführt.
Siehe Tabelle 1
Tabelle 1: Unerwünschte Wirkungen, die bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen und Knochenbefall, Multiplem Myelom oder mit Riesenzelltumoren des Knochens berichtet wurden
Systemorganklassen gemäß
MedDRA | Häufigkeitskategorie | Unerwünschte Wirkungen |
| Gutartige, bösartige und nicht spezifizierte Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen) | Häufig | Neues primäres Malignom1 |
| Erkrankungen des Immunsystems | Selten | Arzneimittelüberempfindlichkeit1 |
| Selten | Anaphylaktische Reaktion1 |
Stoffwechsel- und
Ernährungsstörungen | Sehr häufig | Hypokalzämie1, 2 |
| Häufig | Hypophosphatämie |
| Gelegentlich | Hyperkalzämie nach Behandlungsende bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens3 |
Erkrankungen der Atemwege,
des Brustraums und Mediastinums | Sehr häufig | Dyspnoe |
Erkrankungen
des Gastrointestinaltrakts | Sehr häufig | Diarrhö |
| Häufig | Zahnextraktion |
| Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes | Häufig | Hyperhidrose |
| Gelegentlich | Lichenoide Arzneimittelexantheme1 |
| Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen | Sehr häufig | Muskuloskelettale Schmerzen1 |
| Häufig | Kieferosteonekrose1 |
| Gelegentlich | Atypische Femurfraktur1 |
| Nicht bekannt | Osteonekrose des äußeren
Gehörgangs3, 4 |
1 Siehe Abschnitt „Beschreibung ausgewählter unerwünschter Wirkungen“
2 Siehe Abschnitt „Andere spezielle Populationen“
3 Siehe Abschnitt 4.4
4 Klasseneffekt
Beschreibung ausgewählter unerwünschter WirkungenHypokalzämieEine höhere Inzidenz von Hypokalzämie wurde in klinischen Studien zur Prävention von SRE bei Patienten, die mit Denosumab behandelt wurden, im Vergleich zu Zoledronsäure beobachtet.
Die höchste Inzidenz von Hypokalzämie wurde in einer Phase-III-Studie bei Patienten mit Multiplem Myelom beobachtet. Hypokalzämie wurde bei 16,9 % der Patienten, die mit XGEVA behandelt wurden, und bei 12,4 % der Patienten, die mit Zoledronsäure behandelt wurden, berichtet. Ein Absinken der Serumcalciumspiegel Grad 3 trat bei 1,4 % der mit XGEVA behandelten Patienten und bei 0,6 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten auf. Ein Absinken der Serumcalciumspiegel Grad 4 trat bei 0,4 % der mit XGEVA behandelten Patienten und bei 0,1 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten auf.
In drei aktiv kontrollierten klinischen Studien der Phase III bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen und Knochenbefall wurde bei 9,6 % der mit XGEVA und bei 5,0 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten über Hypokalzämie berichtet.
Ein Absinken der Serumcalciumspiegel Grad 3 trat bei 2,5 % der mit XGEVA und 1,2 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten auf. Ein Absinken der Serumcalciumspiegel Grad 4 trat bei 0,6 % der mit XGEVA und 0,2 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten auf (siehe Abschnitt 4.4).
In zwei einarmigen klinischen Studien der Phase II bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens wurde bei 5,7 % der Patienten über Hypokalzämie berichtet. Keines der unerwünschten Ereignisse wurde als schwerwiegend eingestuft.
Nach Markteinführung wurde über schwere symptomatische Hypokalzämie (einschließlich Fälle mit tödlichem Ausgang) berichtet, wobei die Mehrzahl der Fälle in den ersten Wochen nach Therapiebeginn auftrat. Beispiele klinischer Manifestationen schwerer symptomatischer Hypokalzämie schlossen QT-Intervallverlängerungen, Tetanie, Krampfanfälle und veränderten mentalen Status (einschließlich Koma) ein (siehe Abschnitt 4.4). In klinischen Studien schlossen die Symptome einer Hypokalzämie Parästhesien oder Muskelsteifheit, Zuckungen, Spasmen und Muskelkrämpfe ein.
Kieferosteonekrose (ONJ)Die Inzidenz von ONJ war in klinischen Studien bei längerer Expositionsdauer höher. ONJ wurde auch nach dem Ende der Behandlung mit XGEVA diagnostiziert, wobei die Mehrheit der Fälle innerhalb von 5 Monaten nach der letzten Dosis auftrat. Patienten mit einer Vorgeschichte einer ONJ oder Osteomyelitis des Kiefers, bestehendem Zahn- oder Kieferbefund, der eine Operation im Mundbereich erfordert, nicht verheilten operativen Zahn-/Mundeingriffen oder jedwedem geplanten invasiven zahnärztlichen Eingriff waren aus den klinischen Studien ausgeschlossen.
Eine höhere Inzidenz von ONJ wurde in klinischen Studien zur Prävention von SRE bei Patienten, die mit Denosumab behandelt wurden, im Vergleich zu Zoledronsäure beobachtet. Die höchste Inzidenz von ONJ wurde in einer Phase-III-Studie bei Patienten mit Multiplem Myelom beobachtet. In der doppelt verblindeten Behandlungsphase dieser Studie wurde ONJ bei 5,9 % der Patienten, die mit XGEVA behandelt wurden (mediane Exposition von 19,4 Monaten; Bereich 1 – 52), und bei 3,2 % der Patienten, die mit Zoledronsäure behandelt wurden, bestätigt. Bei Beendigung der doppelt verblindeten Behandlungsphase dieser Studie lag die nach Patientenjahren adjustierte Inzidenz einer bestätigten ONJ in der XGEVA-Gruppe (mediane Exposition von 19,4 Monaten; Bereich: 1 – 52) bei 2,0 pro 100 Patientenjahre während des ersten Behandlungsjahres, bei 5,0 im zweiten Jahr und danach bei 4,5. Die mediane Zeit bis zum Auftreten einer ONJ lag bei 18,7 Monaten (Bereich: 1 – 44).
In den primären Behandlungsphasen von drei aktiv kontrollierten klinischen Studien der Phase III bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen und Knochenbefall wurde ONJ bei 1,8 % der mit XGEVA (mediane Exposition von 12,0 Monaten; Bereich: 0,1 – 40,5) und 1,3 % der mit Zoledronsäure behandelten Patienten bestätigt. Die klinischen Charakteristika dieser Fälle waren in den Behandlungsgruppen ähnlich.
Unter den Patienten mit bestätigter ONJ hatten die meisten (81 % in beiden Behandlungsgruppen) eine Vorgeschichte von Zahnextraktion, schlechter Mundhygiene und/ oder Verwendung von Zahnersatz. Die meisten Patienten erhielten eine Chemotherapie oder hatten eine erhalten.
Die Studien bei Patienten mit Mamma- oder Prostatakarzinom schlossen eine verlängerte Behandlungsphase mit XGEVA ein (mediane Gesamtexposition von 14,9 Monaten; Bereich: 0,1 – 67,2). Eine ONJ wurde bei 6,9 % der Patienten mit Mamma- und Prostatakarzinom während der verlängerten Behandlungsphase bestätigt.
Die nach Patientenjahren adjustierte Gesamtinzidenz einer bestätigten ONJ lag bei 1,1 pro 100 Patientenjahre während des ersten Behandlungsjahres, bei 3,7 im zweiten Jahr und danach bei 4,6. Die mediane Zeit bis zum Auftreten einer ONJ betrug 20,6 Monate (Bereich: 4 – 53).
In einer nicht randomisierten, retrospektiven Beobachtungsstudie bei 2 877 mit XGEVA oder Zoledronsäure behandelten Krebspatienten in Schweden, Dänemark und Norwegen lag der 5-Jahres-Inzidenzanteil medizinisch bestätigter ONJ bei 5,7 % (95 % KI: 4,4; 7,3; mittlere Nachbeobachtungszeit von 20 Monaten [Bereich: 0,2 – 60]) in der mit XGEVA behandelten Patientenkohorte und bei 1,4 % (95 % KI: 0,8; 2,3; mittlere Nachbeobachtungszeit von 13 Monaten [Bereich: 0,1 – 60]) in der mit Zoledronsäure behandelten Patientenkohorte. Der 5-Jahres-Inzidenzanteil von ONJ bei Patienten, die von Zoledronsäure auf XGEVA wechselten, lag bei 6,6 % (95 % KI: 4,2; 10,0; mittlere Nachbeobachtungszeit von 13 Monaten [Bereich: 0,2 – 60]).
In einer Studie der Phase III bei Patienten mit nicht metastasiertem Prostatakarzinom (einer Patientenpopulation, für die XGEVA nicht indiziert ist) und mit längerer Behandlungsexposition von bis zu 7 Jahren lag die nach Patientenjahren adjustierte Inzidenz einer bestätigten ONJ bei 1,1 pro 100 Patientenjahre während des ersten Behandlungsjahres, bei 3,0 im zweiten Jahr und danach bei 7,1.
In einer offenen, klinischen Langzeitstudie der Phase II bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens (Studie 6, siehe Abschnitt 5.1) wurde eine ONJ bei 6,8 % der Patienten, darunter bei einem Jugendlichen, bestätigt (mediane Anzahl von 34 Dosen; Bereich: 4 – 116). Am Ende der Studie betrug die mediane Dauer der Studienteilnahme, einschließlich der Nachbeobachtungsphase zur Beurteilung der Sicherheit, 60,9 Monate (Bereich: 0 – 112,6). Die nach Patientenjahren adjustierte Inzidenz einer bestätigten ONJ lag bei insgesamt 1,5 pro 100 Patientenjahre (0,2 pro 100 Patientenjahre während des ersten Behandlungsjahres, 1,5 im zweiten Jahr, 1,8 im dritten Jahr, 2,1 im vierten Jahr, 1,4 im fünften Jahr und danach 2,2). Die mediane Zeit bis zu einer ONJ betrug 41 Monate (Bereich: 11 – 96).
Studie 7 wurde durchgeführt, um Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens (GCTB,
giant cell tumour of bone), die in Studie 6 behandelt wurden, für weitere 5 Jahre oder länger nachzuverfolgen. ONJ wurde bei 6 der 51 Patienten (11,8 %), die einer mittleren Gesamtdosis von 42 Dosen Denosumab exponiert waren, berichtet. Drei dieser ONJ-Fälle wurden ärztlich bestätigt.
Arzneimittelbedingte ÜberempfindlichkeitsreaktionenNach der Markteinführung wurde bei Patienten, die XGEVA erhielten, über Ereignisse von Überempfindlichkeit, einschließlich seltener Fälle von anaphylaktischen Reaktionen, berichtet.
Atypische FemurfrakturenInsgesamt wurde im klinischen Studienprogramm bei Patienten, die mit XGEVA behandelt wurden, gelegentlich über atypische Femurfrakturen berichtet, wobei sich das Risiko bei längerer Behandlungsdauer erhöhte. Ereignisse traten während der Behandlung und bis zu 9 Monate nach Behandlungsende auf (siehe Abschnitt 4.4).
Im klinischen Studienprogramm für GCTB wurde bei Patienten, die mit XGEVA behandelt wurden, häufig über atypische Femurfrakturen (AFF) berichtet. In Studie 6 bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens betrug die Inzidenz bestätigter AFF 0,95 % (5/526). In der Folgestudie 7 lag die Inzidenz bestätigter AFF bei mit Denosumab behandelten Patienten bei 3,9 % (2/51).
Muskuloskelettale SchmerzenMuskuloskelettale Schmerzen, einschließlich schwerer Fälle, wurden nach Markteinführung bei Patienten berichtet, die mit XGEVA behandelt wurden. In klinischen Studien traten muskuloskelettale Schmerzen sehr häufig sowohl in den Denosumab- als auch in den Zoledronsäure-Behandlungsgruppen auf. Muskuloskelettale Schmerzen, die zum Abbruch der Studienbehandlung führten, traten selten auf.
Neues primäres MalignomIn den primären doppelblinden Behandlungsphasen von vier aktiv kontrollierten klinischen Studien der Phase III bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen und Knochenbefall wurde über neue primäre Malignome berichtet bei 54/3 691 (1,5 %) der Patienten, die mit XGEVA behandelt wurden (mediane Exposition von 13,8 Monaten; Bereich: 1,0 – 51,7), und bei 33/3 688 (0,9 %) der Patienten, die mit Zoledronsäure behandelt wurden (mediane Exposition von 12,9 Monaten; Bereich: 1,0 – 50,8).
Die kumulative Inzidenz nach einem Jahr betrug 1,1 % für Denosumab und 0,6 % für Zoledronsäure.
Es war für einzelne oder Gruppen von Krebserkrankungen kein behandlungsbedingtes Muster zu erkennen.
In Studie 6 lag bei Patienten mit Riesenzelltumoren des Knochens die Inzidenz des Auftretens neuer Malignome, einschließlich maligner Erkrankungen des Knochens und außerhalb des Knochens, bei 3,8 % (20/526). In der Folgestudie 7 lag die Inzidenz bei mit Denosumab behandelten Patienten bei 11,8 % (6/51).
Lichenoide ArzneimittelexanthemeLichenoide Arzneimittelexantheme (z. B. Lichen planus-artige Reaktionen) wurden nach Markteinführung bei Patienten berichtet.
Kinder und JugendlicheXGEVA wurde in einer offenen Studie untersucht, in die 28 skelettal ausgereifte Jugendliche mit Riesenzelltumoren des Knochens eingeschlossen wurden. Basierend auf diesen limitierten Daten schien das Profil der unerwünschten Ereignisse mit dem der Erwachsenen vergleichbar zu sein.
Eine klinisch signifikante Hyperkalzämie nach Behandlungsende wurde nach Markteinführung bei Kindern und Jugendlichen berichtet (siehe Abschnitt 4.4).
Andere spezielle PopulationenNierenfunktionsstörung
In einer klinischen Studie bei Patienten ohne fortgeschrittene Krebserkrankung mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) oder bei dialysepflichtigen Patienten lag ein höheres Risiko vor, eine Hypokalzämie zu entwickeln, wenn keine Calciumergänzung erfolgte. Das Risiko, eine Hypokalzämie während der XGEVA-Behandlung zu entwickeln, erhöht sich mit steigendem Grad der Nierenfunktionsstörung. In einer klinischen Studie bei Patienten ohne fortgeschrittene Krebserkrankung entwickelten 19 % der Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) und 63 % der dialysepflichtigen Patienten eine Hypokalzämie trotz Calciumergänzung. Die Gesamtinzidenz einer klinisch signifikanten Hypokalzämie lag bei 9 %.
Begleitende Erhöhungen der Parathormonspiegel wurden ebenfalls bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung oder bei dialysepflichtigen Patienten beobachtet, die XGEVA erhielten. Die Überwachung der Calciumspiegel sowie eine adäquate Einnahme von Calcium und Vitamin D sind bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung besonders wichtig (siehe Abschnitt 4.4).
Meldung des Verdachts auf NebenwirkungenDie Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem
Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Paul-Ehrlich-Institut
Paul-Ehrlich-Str. 51-59
63225 Langen
Tel: +49 6103 77 0
Fax: +49 6103 77 1234
Website: www.pei.de
anzuzeigen.